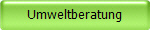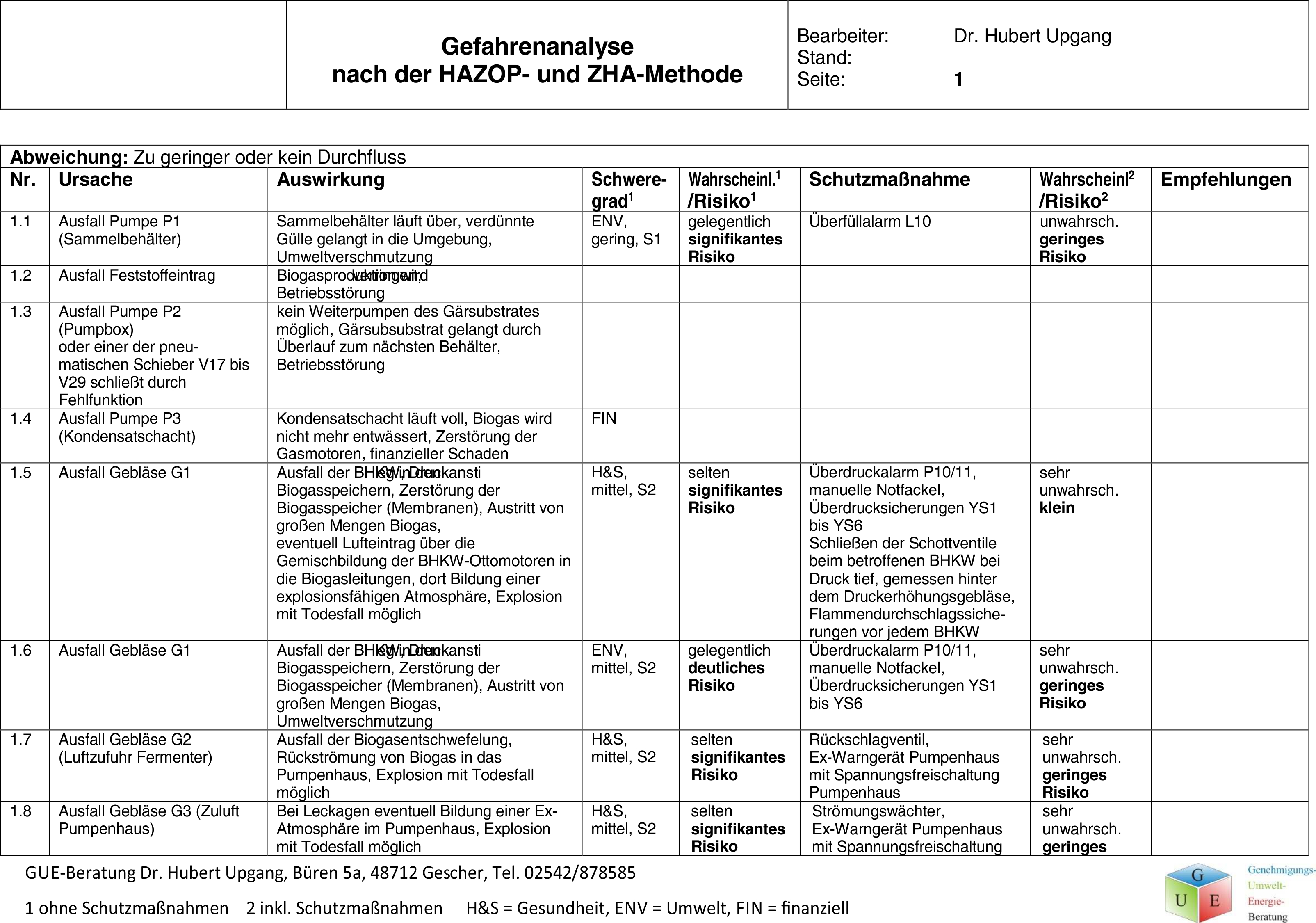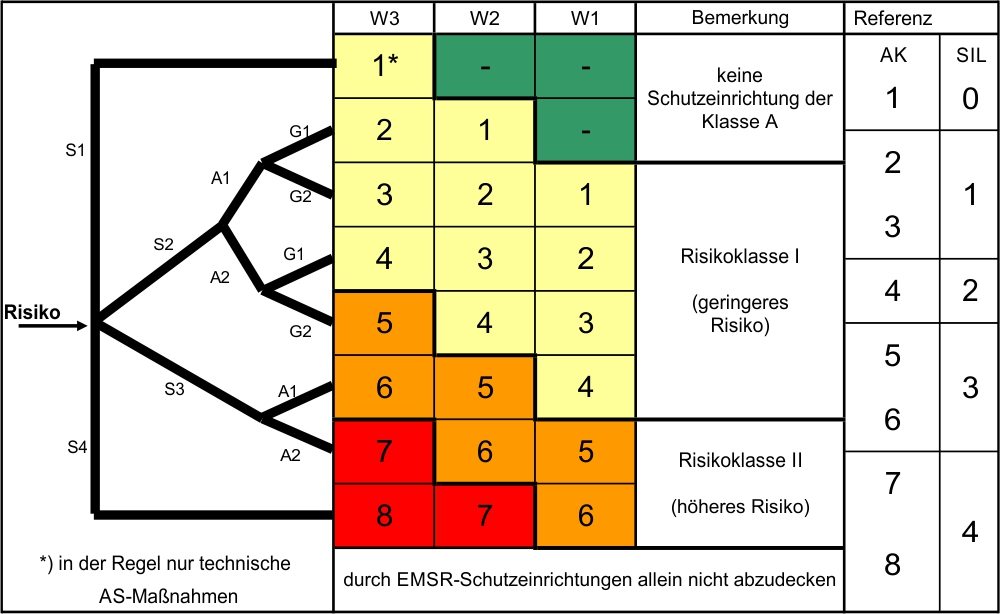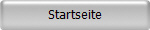
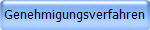
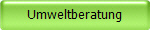
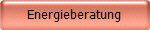
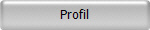
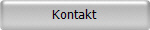
Gemäß
§ 9, Abs. 1, Nr. 2 der Störfallverordnung hat der Betreiber eines
Betriebsbereiches der oberen Klasse die von der/den Anlage(n)
ausgehenden Gefahren
für
Störfälle und mögliche Störfallszenarien zu ermitteln und darzulegen,
welche Maßnahmen zur Vermeidung dieser Störfälle und zur Begrenzung der
Auswirkungen
auf
die menschliche Gesundheit und Umwelt ergriffen werden. Dies erfolgt in
Form einer Gefahrenanalyse, die damit ein maßgeblicher Teil des
Sicherheitsberichtes
ist.
Darüber hinaus fordern Genehmigungs- und Überwachungsbehörden heute
oftmals auch für Betriebsbereiche der unteren
Klasse eine Gefahrenanalyse, die dann
Bestandteil des Störfallkonzeptes wird.
In den letzten Jahrzenten wurden zahlreiche Methoden zur Durchführung
von Gefahrenanalysen für Verfahrensanlagen entwickelt. Am weitesten Verbreitet und auch
in
Deutschland seit mehr als 10 Jahren von den Behörden akzeptiert sind eine modifizierte FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse (FMEA) und das HAZOP-
Verfahren (Hazard and Operability). Das FMEA-Verfahren stammt ursprünglich aus der
Fertigungsindustrie (z. B. Automobilbau) und diente in erster Linie zur
Qualitätssicherung. In einer etwas modifizerten Variante wird es jetzt aber auch bei
verfahrenstechnischen Anlagen zur Ermittlung der Verfahrenssicherheit einge-
setzt. Das HAZOP-Verfahren ist in Deutschland auch unter dem Namen PAAG (Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkungen, Gegenmaß-
nahmen)
bekannt. Eine Weiterentwicklung, die auch bereits eine einfache
Bewertung der Risiken beinhaltet, ist das ZHA-Verfahren (Zürich Hazard Analysis).
Sowohl das FMEA-, als auch das HAZOP-Verfahren wird mit einem Team von
Experten durchgeführt, das aus Betriebsleuten, Projekt- oder
Verfahrensinge-
nieuren, Mess- und Regelungstechnikern, Maschinentechnikern und
Prozesssicherheitsleuten besteht. Bei beiden Verfahren handelt es sich
um gelenkte
Brainstorming Verfahren. Die Lenkung erfolgt beim FMEA-Verfahren anhand
der systematischen Abfrage von Schachstellen in Form einer Stichwort- oder Check-
liste
und beim HAZOP-Verfahren anhand der Festlegung von Abweichungen vom
Normalprozess (zu hohe/niedrige Temperatur, zu hoher/niedriger Druck,
usw.).
Das FMEA-Verfahren kann bereits in einem relativ frühen Projektstadium
angewendet werden und wird daher oftmals auch zur Bewertung
alternativer Verfahrens-
technologien im Hinblich auf Sicherheit und Umweltverträglichkeit
eingesetzt. Demgegenüber müssen für eine HAZOP-Studie bereits
detaillierte Regelungs- und
Instrumentierungs-Fließbilder
und Ursache-Wirkungs-Diagramme für die geplanten (Schutz)schaltungen
vorliegen. Wie der Name "Operability" bereits andeutet,
kann das HAZOP-Verfahren auch zur Optimierung eines Verfahrens und Vermeidung finazieller Schäden verwendet werden.
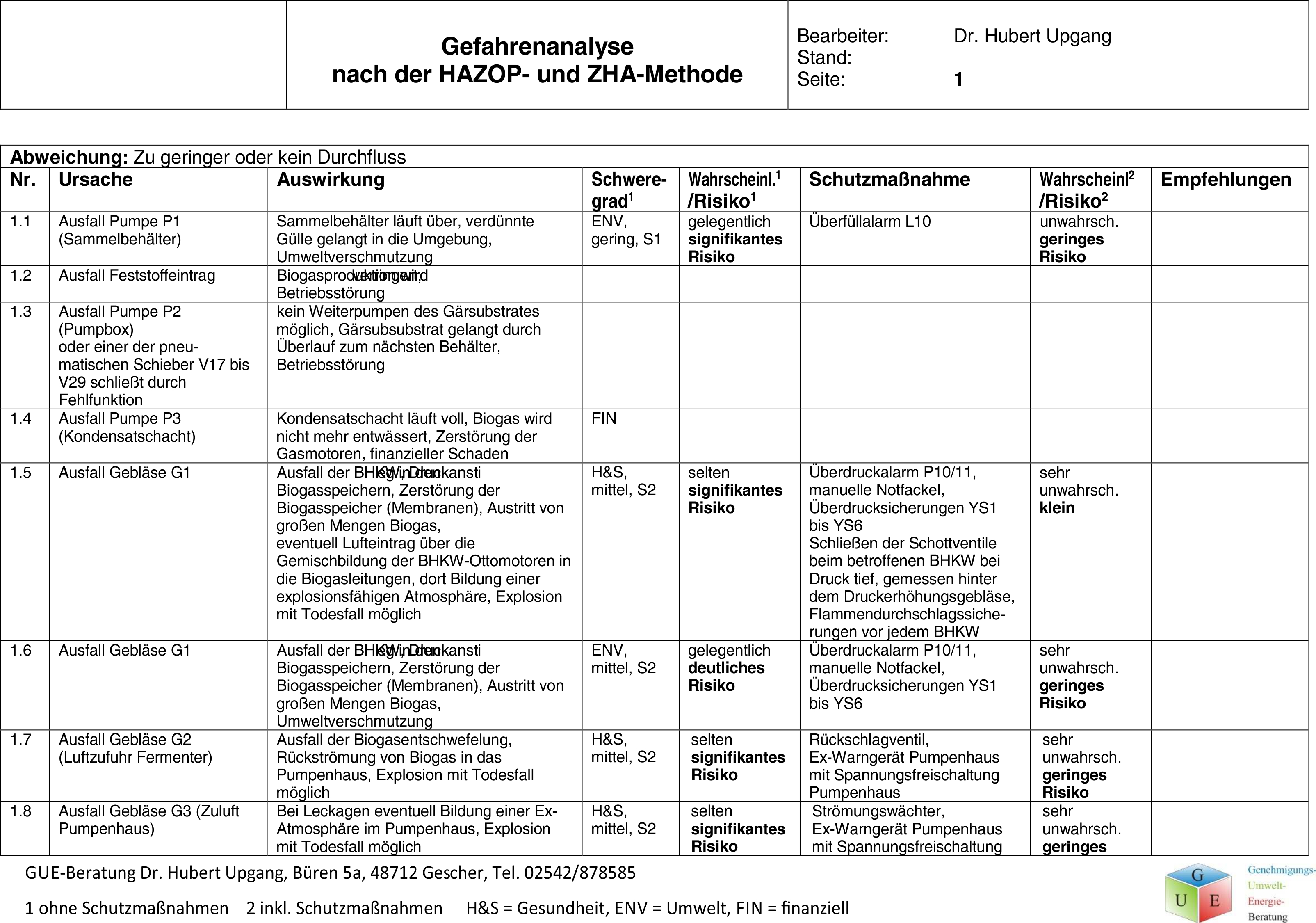
In einer Gefahrenanalyse werden mögliche Gefahren (Störfälle) und deren Ursachen und Auswirkungen ermittelt sowie Maßnahmen
vorgeschlagen, wie sich diese
Störfälle verhindern oder in ihren Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen
und Umwelt verringern lassen. Eine Bewertung des dadurch
vorhandenen Risikos
erfolgt nicht oder nur qualitativ (geschätztes Risiko). Unter Risiko
versteht man dabei allgemein das Produkt aus Schweregrad des Störfalls
und Eintrittswahrschein-
lichkeit. Zudem unterbleibt eine Beurteilung, ob mit der
vorgeschlagenen Schutzmaßnahme das Risiko ausreichend vermindert werden kann,
oder eventuell zusätzliche
Maßnahmen parallel ergriffen werden müssen.
Da sich nicht alle Gefahren mit noch vertretbarem finanziellen Aufwand vollständig ausschließen lassen, muss im Rahmen
einer quantitativen Bewertung festgelegt werden,
welches Risko noch
zulässig sein soll. Hierfür wird ein Risikoprofil ermittelt, das in einer Matrix über
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schweregrad eine Treppenfunktion
des Grenzrisikos darstellt. Ein Störfall mit mehreren Toten
beispielsweise darf sich wesentlich seltener ereignen, als ein
Störfall, der zu
einer geringen lokalen Umweltver-
schmutzung führt. Große Unternehmen
haben zumeist ihre eigene Risikomatrix ermittelt. Liegt eine solche nicht vor, ist zumeist eine
Abstufung des Schweregrades in
Anlehnung an die VDI/VDE 2180 sinnvoll und von den Behörden akzeptiert.
Möglichkeiten zur Bewertung des Risikos sind beispielsweise die
Ermittlung der RisikoPrioritätsZahl (RPZ) beim FMEA-Verfahren oder die Berechnung der vorhanden
und erforderlichen RisikoReduktionsFaktoren (RRF) beim LOPA-Verfahren. Das LOPA-Verfahren (Layer of Protection Analysis) baut auf dem HAZOP-Verfahren auf
und ist ein semiquantitatives Risikoermittlungsverfahren. Dies
bedeutet, dass hier die Eintrittswahrscheinlichkeit numerisch anhand
weltweit ermittelter Ausfallraten von
verfahrenstechnischen Bauteilen und Schutzeinrichtungen berechnet und
mit einer noch zulässigen Eintrittswahrscheinlichkeit verglichen wird.
Dagegen erfolgt die
Ermittlung
des Schweregrades hier zumeist qualitativ. Anhand von bereits
vorliegenden Tabellen oder durchgeführten Ausbreitungsrechnungen für
Schadgase und Druck-
wellen und Wärmestrahlungen kann aber auch hier unter Berücksichtigung
der Emissionsraten und des Umfeldes eine quantitative Ermittlung
durchgeführt werden.
Ist der
erforderliche Risikoreduktionsfaktor für eine Schutzeinrichtung (z. B.
Schutzschaltung) ermittelt, wird bestimmt, ob die vorgesehene
Schutzeinrichtung hierfür ausreichend
zuverlässig ist (Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung) und
beispielsweise eine Schutzschaltung den erforderlichen SIL-Faktor
auch erreicht. Ist dies nicht der Fall, muss
über Möglichkeiten der Erhöhung
der Zuverlässigkeit der Schutzeinrichtung oder über zusätzliche parallele Schutzeinrichtungen nachgedacht werden.
Das LOPA-Verfahren zur Bewertung der ausreichenden Zuverlässigkeit der
geplanten Schutzeinrichtungen und zur Ermittlung des erforderlichen
SIL-Faktors bei Schutz-
schaltungen stammt aus dem angelsächsischem Raum und beginnt sich jetzt
auch in Deutschland zu etablieren. Bisher war hier eher die
Verwendung des SIL-Graphen
Verfahrens üblich und von den Behörden anerkannt. Während der SIL-Graph
jedoch speziell für die Bewertung von Schutzschaltungen verwendet wird, ist das LOPA-
Verfahren in den letzten 10 Jahren auch zur Bewertung anderer
Schutzeinrichtungen (z. B. Sicherheitsventile, Alarme in Verbindung mit
Operatorrekationen, mechanische
Barrieren, usw.) weiter entwickelt worden und ist somit wesentlich universeller einsetzbar.
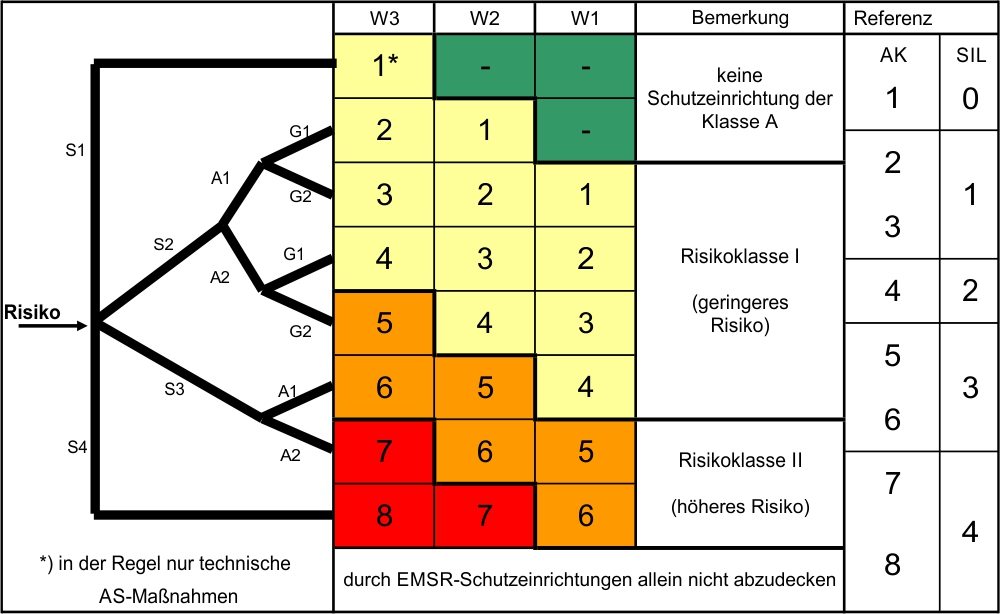
SIL-Graph zur Ermittlung der erforderlichen SIL-Klasse einer Schutzschaltung